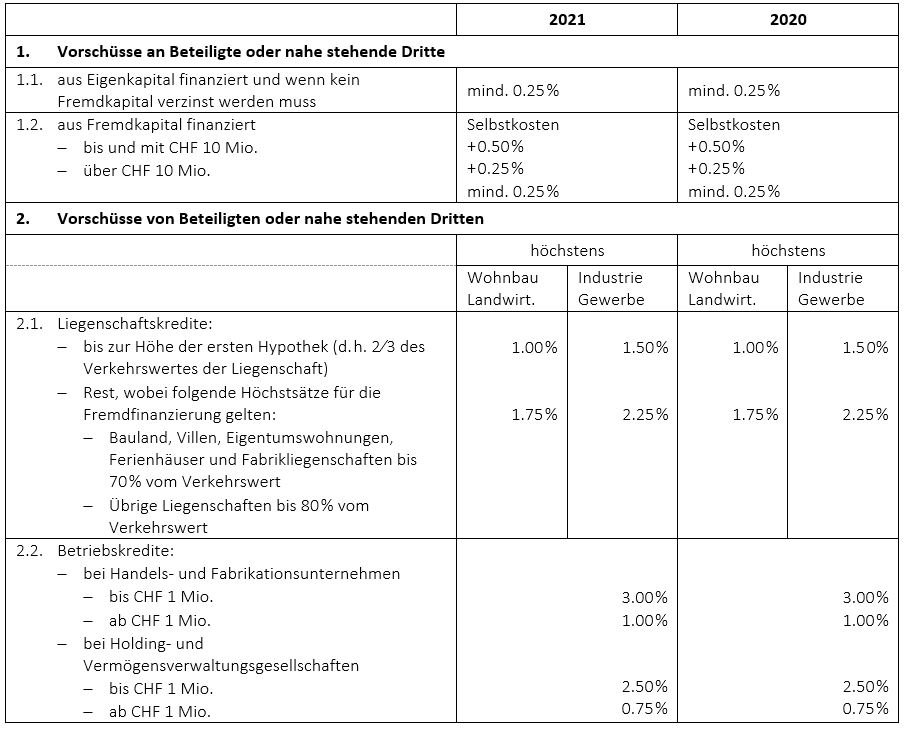Steuerfreier Kapitalgewinn vs. steuerbarer Vermögensertrag – Teil 2
In Teil 1 haben wir die Tätigkeiten aus gewerbsmässigem Wertschriftenhandel, Liegenschaftenhandel und Kunsthandel beleuchtet. Im zweiten Teil folgt nun Behandlung von Transaktionen mit Kapitalgesellschaften.
2. REGELUNG DES STEUERFREIEN KAPITALGEWINNS
2.1 Gesetzliche Regelung. Art. 16 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie Art. 7 Abs. 4 lit. b des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) halten explizit fest, dass Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (DBG) respektive beweglichem Privatvermögen (StHG) steuerfrei sind. Gemäss bisheriger und ständiger Praxis des Bundesgerichts, gelten als steuerfreie private Kapitalgewinne im Sinne von Art. 16 Abs. 3 DBG nur diejenigen Gewinne, welche aus der schlichten Verwaltung des privaten Vermögens herrühren oder bei einer sich zufällig bietenden Gelegenheit entstehen. Eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit kann demgegenüber zur Annahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit und somit zur Besteuerung des erzielten Kapitalgewinns führen.
3. KAPITALGEWINNE BEI GESELLSCHAFTSVERKÄUFEN
Grundsätzlich kann bei der Veräusserung von privat gehaltenen Gesellschaften ein steuerfreier privater Kapitalgewinn erzielt werden, sofern dieser nicht eingeschränkt wird, wie zum Beispiel beim Vorliegen einer indirekten Teilliquidation, einer Transponierung oder eines gemischten Vertrags.
Nachfolgend werden diese drei Themen genauer beleuchtet.
3.1 Indirekte Teilliquidation. Aufgrund der Möglichkeit private Kapitalgewinne steuerfrei zu realisieren, verfügen privat gehaltene Gesellschaften (nachfolgend «Zielgesellschaft») oftmals über substantielle Gewinnvorträge. Damit der Eigentümer der Zielgesellschaft diese Gewinnvorträge steuerlich optimal vereinnahmen kann, werden diese vor einem allfälligen Verkauf nicht ausgeschüttet, vielmehr werden sie mitverkauft und der Kaufpreis für die Zielgesellschaft entsprechend erhöht. Da der Käufer der Zielgesellschaft auf die in der Zielgesellschaft vorhandenen Mittel greifen möchte, will er sich diese in der Regel unmittelbar nach dem Erwerb als Dividende ausschütten. Handelt es sich beim Käufer um eine natürliche oder juristische Person, welche die Zielgesellschaft im Geschäftsvermögen hält, so führt eine solche Substanzausschüttung unter dem Titel der indirekten Teilliquidation beim Verkäufer zu einer Besteuerung als Vermögensertrag (Art. 20a Abs. 1 lit. a DBG bzw. Art. 7a Abs. 1 lit. a StHG; Kreisschreiben Nr. 14 (KS Nr. 14 ESTV) [21].
Eine indirekte Teilliquidation liegt vor, wenn folgende Tatbestandsmerkmale kumulativ erfüllt werden:
- Übertragung erfolgt durch Verkauf;
2. qualifizierende Beteiligung (mindestens 20% am Grund- oder Stammkapital einer juristischen Person) wird veräussert;
3. Beteiligungsrechte, die Privatvermögen einer in der Schweiz ansässigen natürlichen Person darstellen, werden an einen Käufer (juristische oder natürliche Person) veräussert, welcher die Beteiligung im Geschäftsvermögen hält;
4. im Zeitpunkt des Verkaufs besteht nichtbetriebsnotwendige und handelsrechtlich ausschüttungsfähige Substanz, welche innerhalb von fünf Jahren ausgeschüttet wird;
5. Verkäufer weiss (oder muss wissen) um die Entnahme der Mittel.
Bei kumulativer Erfüllung der Tatbestandsmerkmale, erfolgt eine Einkommensbesteuerung aus Vermögensertrag, berechnet auf Basis der kleinsten Grösse aus:
- Verkaufserlös;
- Ausschüttungsbetrag
- handelsrechtlich ausschüttungsfähigen Reserven gemäss letzter Bilanz vor Verkauf
- nichtbetriebsnotwendiger Substanz.
Auf die folgenden Punkte sei explizit hingewiesen:
- Bei zeitlich gestaffelten Verkäufen von mehreren Beteiligungspaketen an derselben Gesellschaft, kann die indirekte Teilliquidation ebenfalls zum tragen kommen, sofern innert fünf Jahren seit dem ersten Verkauf insgesamt mindestens 20% an der Zielgesellschaft verkauft werden. Unbeachtlich ist dabei, ob die Verkäufe an denselben Käufer erfolgen.
- Die qualifizierende Beteiligungsquote wird auch erreicht, wenn mehrere natürliche Personen aufgrund einer gemeinsamen Willensbildung zusammen mindestens 20% an der Zielgesellschaft veräussern.
- Keine Substanzausschüttung liegt vor, wenn Dividenden aus den ab dem Verkaufsjahr erzielten ordentlichen Jahresgewinnen der Zielgesellschaft ausgeschüttet werden. Beinhaltet der Jahresgewinn ausserordentliche Erträge, so ist zu differenzieren, ob diese aus der Veräusserung von betriebsnotwendigem oder nicht-betriebsnotwendigem Anlagevermögen stammen.
- Die Gewährung eines Darlehens der Zielgesellschaft an den Käufer ist nur dann schädlich, wenn das Darlehen nicht dem Drittvergleich standhält, eine Rückzahlung gefährdet erscheint und bei der darlehensgebenden Zielgesellschaft eine Vermögenseinbusse bewirkt wird.
Ein Verkäufer kann sich vor den Steuerfolgen einer indirekten Teilliquidation schützen, indem er sich beim Kaufvertrag eine Vertragsklausel ausbedingt, in welcher ihm der Käufer zusichert, dass er während fünf Jahren keine Handlungen vornehmen wird, welche beim Verkäufer zu einer Besteuerung aufgrund indirekter Teilliquidation führen würden. Sollte der Käufer dennoch solche Handlungen vornehmen, verpflichtet er sich, den Verkäufer für die erlittenen Steuerfolgen schadlos zu halten.
In der Praxis hat die indirekte Teilliquidation insbesondere durch die Möglichkeit der Darlehensgewährung durch die Zielgesellschaft an Brisanz verloren. Dennoch ist es ein Thema, welches bei einem Verkauf einer Gesellschaft durch eine natürliche Person sauber analysiert und im Vertrag entsprechend reflektiert werden muss. Je nach Situation empfiehlt es sich auch, das Thema mit der zuständigen Steuerbehörde anzuschauen.
4.2 Transponierung (Übertragung an selbstbeherrschte Gesellschaft). Überträgt ein Aktionär seine privat gehaltenen Beteiligungsrechte an eine von ihm beherrschte Gesellschaft, so kann dies gemäss Art. 20a Abs. 1 lit. b DBG resp. Art. 7a Abs. 1 lit. b StHG zu steuerbarem Vermögensertrag führen, sofern der Aktionär
- Beteiligungsrechte unabhängig von Anzahl oder Beteiligungsquote am Grund- oder Stammkapital einer juristischen Person überträgt
- die Beteiligungsrechte zu einem über deren Nennwert und deren Kapitaleinlagereserven liegenden Anrechnungswert überträgt, sei es gegen Aktienkapital, Kapitaleinlagereserven oder Darlehen
- zu mehr als 50% am Kapital der übernehmenden Gesellschaft beteiligt ist.
Da wirtschaftlich eine solche Übertragung nicht als Veräusserung, sondern als Vermögensumschichtung qualifiziert – wobei steuerbares Substrat in steuerfrei rückzahlbares Substrat umgewandelt wird – spricht man auch von Transponierung. Die Regeln der Transponierung finden auch dann Anwendung, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.
Wird eine über dem Nennwert und den Kapitaleinlagereserven der Beteiligung liegende Gegenleistung erbracht, so ist sicherzustellen, dass der überschiessende Betrag den übrigen Reserven gutgeschrieben wird und nicht etwa den Kapital- einlagereserven, da ansonsten Steuerfolgen resultieren.
Werden die Voraussetzungen der Transponierung erfüllt, bemisst sich der daraus steuerbare Vermögensertrag aus dem Erlös aus der Übertragung abzüglich des Nennwerts der übertragenen Beteiligung und den anteiligen Kapitaleinlagereserven.
Die privilegierte Dividendenbesteuerung gemäss Art. 20 Abs. 1bis DBG findet Anwendung.
4.3 Gemischter Vertrag. Bei einem gemischten Vertrag handelt es sich um einen Vertrag, welcher zusätzlich zum Beteiligungsverkauf noch weitere Elemente enthält, wie z. B. ein Konkurrenzverbot oder auch ein mögliches weiterbestehendes Arbeitsverhältnis des Verkäufers mit der zu verkaufenden Gesellschaft. Als steuerbare Elemente können gemäss jüngster kantonaler Rechtsprechung das mit dem Kaufpreis abgegoltene Konkurrenzverbot oder eine Entschädigung für künftige Mitarbeit, die im Kaufpreis inbegriffen ist, gelten. Bei gemischten Verträgen ist Vorsicht geboten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass z. B. bei einer Weiterbeschäftigung des Verkäufers, dieser eine marktkonforme Entschädigung erhält.
5. FAZIT
Bei sämtlichen Transaktionen in denen ein steuerfreier Kapitalgewinn angestrebt wird, lauern diverse Fallstricke. Eine zunehmend verschäfte Rechtssprechung stellt hohe Anforderungen an die beteiligten Parteien.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.